Der Wunsch nach den eigenen vier Wänden begleitet viele Menschen ein Leben lang. Doch bevor dieser Traum Wirklichkeit werden kann, steht die entscheidende Frage im Raum: Wie viel Eigenkapital ist für den Immobilienkauf erforderlich? Banken wie die Sparkasse, Deutsche Bank oder Commerzbank legen großen Wert auf eine gesunde Eigenkapitalquote, um das Risiko der Finanzierung zu minimieren. Während der Immobilienmarkt 2025 nach wie vor von attraktivem, aber auch herausforderndem Kreditumfeld geprägt ist, beeinflusst das Eigenkapital nicht nur die Höhe des Darlehens, sondern auch die Konditionen maßgeblich. Ohne ausreichende Eigenmittel drohen höhere Zinsen und längere Laufzeiten, was die monatliche Belastung stark ansteigen lässt. Gleichzeitig gibt es vielfältige Möglichkeiten, Eigenkapital zu bilden oder durch staatliche Förderungen und clevere Finanzierungslösungen den Eigenheimkauf dennoch möglich zu machen. Doch welche Faktoren bestimmen die Höhe des Eigenkapitals wirklich? Welche Nebenkosten müssen berücksichtigt werden und wie unterscheiden sich die Anforderungen bei verschiedenen Banken wie der HypoVereinsbank, ING oder Postbank? Dieser Artikel beleuchtet die wichtigen Aspekte rund um das Thema Eigenkapital beim Immobilienerwerb, gibt praktische Beispiele und Tipps, damit Käufer eine fundierte und zukunftssichere Finanzierung planen können.
Eigenkapital beim Immobilienkauf: Definition und Bedeutung für die Finanzierung
Eigenkapital stellt das finanzielle Fundament einer jeden Immobilienfinanzierung dar. Es umfasst alle Mittel, die ein Käufer aus eigenen Ressourcen einbringt, ohne Kredite aufzunehmen. Dabei handelt es sich nicht nur um Ersparnisse auf dem Tagesgeld- oder Festgeldkonto, sondern auch um andere Formen wie Bausparguthaben der Bausparkasse Schwäbisch Hall, Wertpapiere, Fonds, Schenkungen von Angehörigen oder vorhandenes Immobilienvermögen. Sogar die sogenannte Muskelhypothek, bei der Eigenleistungen am Bau angerechnet werden, kann den Eigenkapitalanteil erhöhen.
Die Bedeutung des Eigenkapitals ist vielschichtig. Zunächst reduziert es die Darlehenssumme, wodurch die monatliche Belastung sinkt. Banken sehen ein höheres Eigenkapital als ein geringeres Ausfallrisiko an und gewähren deshalb oft bessere Zinssätze und flexiblere Kreditkonditionen. So ist es beispielsweise bei der Interhyp üblich, dass Banken bei einem Eigenkapitalanteil von mindestens 20-30 % günstigere Angebote machen, da sie das Risiko durch eine größere Sicherheit senken.
Darüber hinaus beeinflusst das Eigenkapital die Zulassungschancen bei Banken wie der DKB (Deutsche Kreditbank) oder Sparda-Bank erheblich. Wer weniger als die empfohlenen 20 % Eigenkapital mitbringt, sieht sich häufig mit höheren Zinsen konfrontiert oder muss zusätzliche Sicherheiten einbringen. Alternativ besteht die Möglichkeit, Einkaufnebenkosten aus Eigenmitteln zu zahlen, da Banken diese üblicherweise nicht finanzieren.
Was zählt genau zum Eigenkapital?
- Bankguthaben: Sparguthaben, Tages- und Festgeldkonten
- Bausparguthaben: Kapital aus Bausparverträgen
- Wertpapiere und Fonds: Aktien, Anleihen, Investmentfonds
- Schenkungen und Erbschaften: Geldübertragungen von Familienmitgliedern
- Eigenleistungen: Bauarbeiten, die als Muskelhypothek anerkannt werden
- Privatdarlehen: Darlehen aus dem familiären oder privaten Umfeld
- Vorhandenes Immobilienvermögen: Beleihung schuldenfreier Immobilien
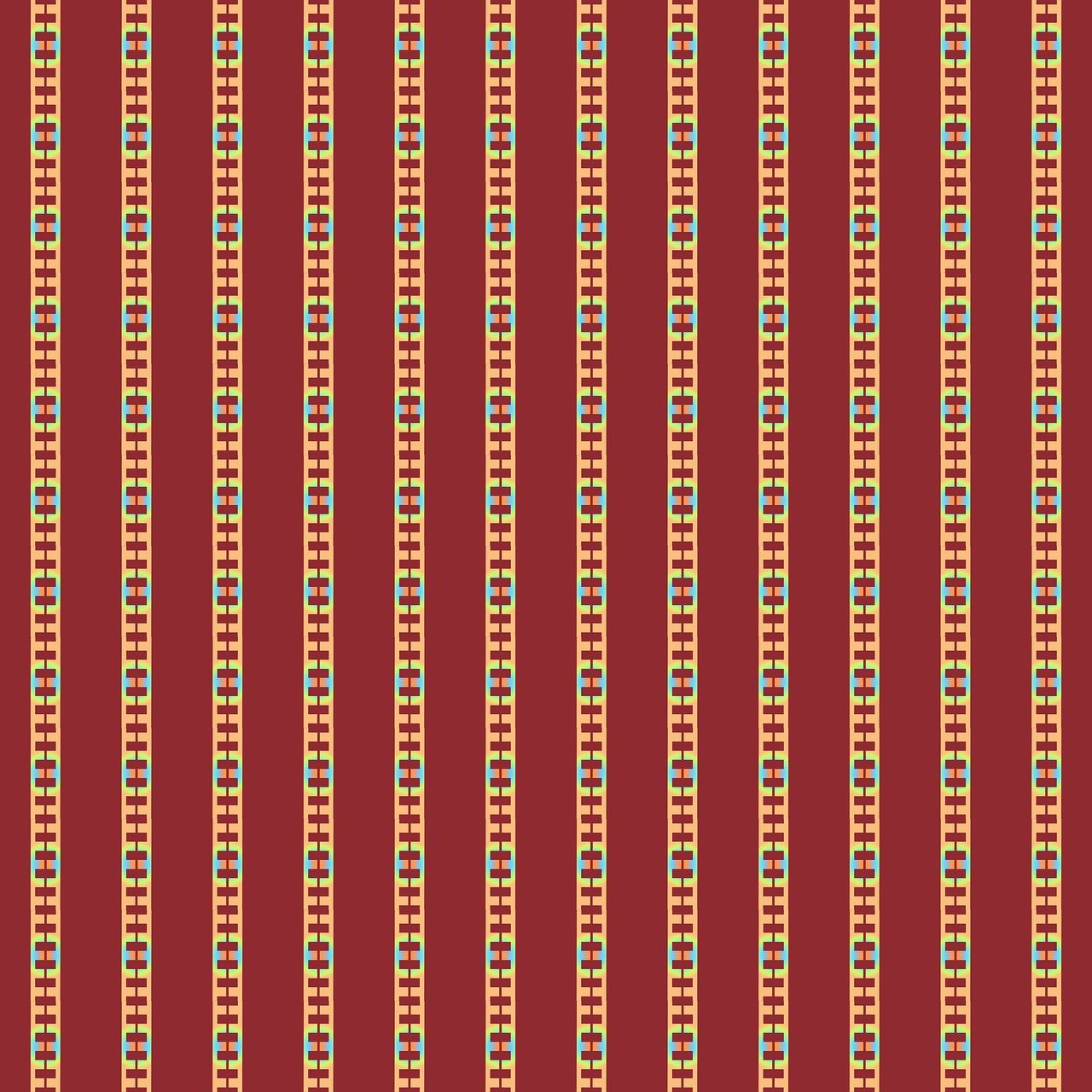
Wie hoch sollte das Eigenkapital mindestens sein? Empfehlungen und Praxisbeispiele
Unterschiedliche Finanzinstitute und Experten sprechen sich für eine Eigenkapitalquote von mindestens 20 bis 30 Prozent des Kaufpreises aus. Diese Zahl basiert auf der Erfahrung, dass Banken ab dieser Schwelle günstigere Zinssätze und deutlich bessere Kreditkonditionen anbieten. Insbesondere betrachten Institute wie die Commerzbank oder HypoVereinsbank einen Eigenkapitalanteil von mindestens 20 % als Richtwert für eine solide Finanzierung.
Ein ausschlaggebender Grund ist die Notwendigkeit, die sogenannten Erwerbsnebenkosten durch Eigenmittel abzudecken. Dazu zählen:
- Grunderwerbsteuer (je nach Bundesland zwischen 3,5 % und 6,5 %)
- Notar- und Grundbuchkosten (ca. 1,5 % bis 2 %)
- Maklerprovision (zwischen 3 % und 7 % des Kaufpreises)
Diese Nebenkosten summieren sich in der Regel auf etwa 10 bis 15 Prozent des Kaufpreises und müssen separat bezahlt werden, da die meisten Banken wie ING oder Postbank diese Posten aus der Finanzierung ausschließen. Folgendes Beispiel verdeutlicht die Verteilung beim Kauf einer Immobilie mit einem Kaufpreis von 400.000 Euro:
| Kostenart | Prozentualer Anteil | Betrag (€) |
|---|---|---|
| Kaufpreis der Immobilie | 100 % | 400.000 |
| Grunderwerbsteuer (5 % Beispiel) | 5 % | 20.000 |
| Notar- und Grundbuchkosten | 1,8 % | 7.200 |
| Maklerprovision (3,57 %) | 3,57 % | 14.280 |
| Gesamtkosten | 110,37 % | 441.480 |
Demnach sollten Eigenkapitalgeber mindestens die Erwerbsnebenkosten von rund 41.480 Euro plus einen Anteil des Kaufpreises selbst durch eigene Mittel aufbringen. Eine Eigenkapitalquote von 20 % des Kaufpreises entspricht somit mindestens 80.000 Euro, was in Kombination mit den Nebenkosten einen Gesamtbetrag von über 120.000 Euro ausmacht.
Doch wie sieht die Praxis aus? Viele Käufer finanzieren bis zu 95 % und mehr des Immobilienpreises, weil sie nicht über so hohe Eigenmittel verfügen. Bei einem geringeren Eigenkapitalanteil verlangen Banken häufig einen Risikoaufschlag, was die Zinsen erhöht und die monatlichen Raten belastet. Deshalb lohnt es sich, frühzeitig Ersparnisse anzusparen oder alternative Wege der Eigenkapitalbildung zu prüfen.
- 20 % Eigenkapital → solide Finanzierung mit günstigen Zinsen
- 30 % Eigenkapital oder mehr → bessere Konditionen und niedrigere Monatsraten
- Unter 20 % → höhere Zinsen, oft höhere Anforderungen an Sicherheiten
Ein beliebtes Mittel zur Eigenkapitalbildung ist die sogenannte Muskelhypothek, bei der Bauherren eigene Arbeitsleistungen in die Finanzierung einbringen und so Kosten für Handwerker sparen können. Das reduziert den benötigten Finanzierungsbedarf und verbessert die Position bei Banken wie der Sparkasse oder Interhyp.

Kaufnebenkosten und ihre Auswirkungen: Was kostet der Immobilienkauf wirklich?
Ein Aspekt, der bei der Kalkulation oft unterschätzt wird, sind die Erwerbsnebenkosten. Wer nur an den Kaufpreis denkt, übersieht schnell, dass diese Zusatzkosten einen erheblichen Teil der Gesamtinvestition ausmachen. Die Höhe der Nebenkosten variiert dabei je nach Bundesland und Immobilientyp stark.
Zu den wichtigsten Nebenposten gehören:
- Grunderwerbsteuer (zwischen 3,5 % – 6,5 %) je nach Bundesland
- Notar- und Grundbuchkosten (ca. 1,5 % – 2 %)
- Maklercourtage (in der Regel 3 % bis 7 %, bei Eigenheimen oft Anteil durch Käufer und Verkäufer geteilt)
Beispielhafte Kosten für eine Bestandsimmobilie mit Kaufpreis 550.000 €:
| Position | Kosten (€) | Prozentual zum Kaufpreis |
|---|---|---|
| Grunderwerbsteuer (5,0 %) | 27.500 | 5,0 % |
| Notar und Grundbuch | 8.250 | 1,5 % |
| Maklercourtage (3,57 % Käuferanteil) | 19.635 | 3,57 % |
| Summe Nebenkosten | 55.385 | 10,07 % |
Die Tatsache, dass diese Nebenkosten von Banken wie der Deutsche Bank oder Sparda-Bank in der Regel nicht finanziert werden, zwingt Käufer, über ausreichend liquide Eigenmittel zu verfügen. Wer diese Summe nicht aus eigener Tasche zahlen kann, kommt in der Regel um einen höheren Kredit nicht herum oder sollte Förderprogramme nutzen.
Einige Bundesländer bieten zudem spezielle Programmkredite und Zuschüsse, um Erwerbsnebenkosten zu erleichtern. Daneben gibt es zinsgünstige Förderungen der KfW oder staatliche Programme wie Wohn-Riester, die oft in Kombination mit Eigenkapital genutzt werden können. Beratung bei Spezialisten ist hierbei essenziell.
Übersicht Erwerbsnebenkosten in Deutschland (Beispiel Bundesländer)
| Bundesland | Grunderwerbsteuer (%) |
|---|---|
| Bayern | 3,5 |
| Berlin | 6,0 |
| Sachsen | 3,5 |
| Nordrhein-Westfalen | 6,5 |
| Hamburg | 4,5 |
Der Immobilienkauf bringt neben dem Kaufpreis auch noch weitere finanzielle Verpflichtungen für Käufer mit sich – sei es die grundsätzliche Absicherung gegen Risiken oder die Instandhaltung. Eigenkapital ist dabei das Ergebnis eines gut geplanten Finanzierungsmodells.
Strategien zur Erhöhung des Eigenkapitals für den Immobilienkauf
Für viele Interessenten stellt die Ansparung des erforderlichen Eigenkapitals eine große Herausforderung dar. Es gibt jedoch verschiedene Wege, zusätzliche finanzielle Mittel zu generieren oder zu mobilisieren:
- Schenkungen oder vorzeitige Erbschaften: Immer häufiger werden Vermögen oder Geldmittel schon vor dem Erbfall übertragen, um als Eigenkapital zu dienen.
- Zinslose oder günstige private Darlehen: Familienmitglieder oder Freunde können Geld zu günstigen Konditionen bereitstellen.
- Verkauf von Vermögenswerten: Nicht genutzte Fahrzeuge, Sammlerstücke oder Grundstücke können veräußert werden, um liquide Mittel zu schaffen.
- Beleihung bestehender Immobilien: Wer bereits Immobilieneigentümer ist, kann durch Beleihung das dort gebundene Kapital freisetzen.
- Erhöhung der Muskelhypothek: Eigenleistungen am Bau helfend einbringen und so Baukosten senken.
Viele bekannte Anbieter wie Interhyp und die Sparkasse beraten zu solchen Strategien umfassend. Eine fundierte Finanzierungsberatung ist besonders dann wichtig, wenn die finanzielle Ausgangslage komplex ist.
Darüber hinaus stehen zahlreiche Förderprogramme zur Verfügung, die unterstützt werden können. Beispiele sind:
- KfW-Förderkredite für energieeffizientes Bauen und Sanieren
- Wohn-Riester für private Altersvorsorge durch Immobilien
- Regionale Unterstützungsprogramme je nach Bundesland

Wie viel Eigenkapital braucht man für den Immobilienkauf?
Wie beeinflussen Banken die Anforderungen an das Eigenkapital? Vergleich wichtiger Kreditinstitute
Die Anforderungen und Konditionen für Eigenkapital variieren von Bank zu Bank deutlich. Institutionen wie Sparkasse, Deutsche Bank, Commerzbank und HypoVereinsbank stehen im direkten Wettbewerb, bieten aber unterschiedliche Standards bei der Eigenkapitalbewertung an.
Folgende Faktoren beeinflussen die Konditionen und die Höhe des geforderten Eigenkapitals:
- Typ und Lage der Immobilie
- Kreditlaufzeit
- Bonität des Käufers
- Vorhandensein von Sicherheiten
- Art des Kredits (z.B. Annuitätendarlehen, KfW-Kredit)
Während Banken wie die ING oder Postbank bei einem hohen Eigenkapitalanteil von 30 % sehr günstige Zinssätze vergeben, sind bei weniger als 10 % Eigenkapital meist hohe Zinsaufschläge üblich. Die DKB (Deutsche Kreditbank) ist hier oft etwas flexibler bei der Eigenkapitalquote, verlangt dafür jedoch häufig höhere Sicherheiten.
Auch die Art der Finanzierung über Bausparkassen wie der Bausparkasse Schwäbisch Hall bietet zusätzliche Möglichkeiten, Eigenkapital durch angesparte Guthaben einzusetzen und damit die Gesamtfinanzierung kostengünstiger zu strukturieren.
Wer seine Finanzierung über einen Vermittler wie Interhyp plant, profitiert von einem großen Netzwerk an Banken und kann die für ihn besten Konditionen finden.
Tabellarischer Vergleich ausgewählter Banken und deren typische Eigenkapitalanforderungen
| Bank | Empfohlenes Eigenkapital | Typische Zinsvorteile bei hohem EK | Besonderheiten |
|---|---|---|---|
| Sparkasse | 20-30 % | deutlich günstiger | Regionale Beratung und Förderprogramme |
| Deutsche Bank | 25 % | günstige Konditionen ab 20 % EK | Bündelung von Konten und Kredit |
| Commerzbank | 20 % | Rabatte ab 20 % EK | Flexible Laufzeiten |
| HypoVereinsbank | 20-30 % | Zinsvorteile ab 25 % EK | Breites Produktportfolio |
| ING | 30 % | Sehr günstige Zinssätze | Online-Abwicklung möglich |
| Postbank | 20 % | Bessere Konditionen ab 20 % EK | Bindung an Kontopflicht |
| DKB | 10-20 % | Zinsaufschläge bei < 10 % EK | Flexibilität bei Sicherheiten |
| Sparda-Bank | 20-25 % | Günstigere Konditionen bei hohem EK | Regionale Beratung |
Häufige Fragen zur Eigenkapitalquote beim Immobilienkauf
Wie viel Eigenkapital benötige ich mindestens für den Kauf einer Immobilie?
Mindestens sollten Sie die Erwerbsnebenkosten von etwa 10 bis 15 % des Kaufpreises zusätzlich zum Kaufpreis teilweise durch Eigenmittel decken. Empfehlenswert sind insgesamt mindestens 20 bis 30 % Eigenkapital.
Kann ich eine Immobilie auch ohne Eigenkapital finanzieren?
Theoretisch ist das möglich, allerdings fordern Banken in solchen Fällen deutlich höhere Zinsen und Sicherheiten, was die Kosten stark erhöht. Förderprogramme und clevere Finanzierungsmodelle können helfen.
Welche Kosten gehören zu den Erwerbsnebenkosten?
Dazu zählen vor allem Grunderwerbsteuer, Notar- und Grundbuchkosten sowie die Maklercourtage, die je nach Bundesland und Immobilientyp variieren können.
Was kann ich tun, wenn ich nicht genug Eigenkapital habe?
Nutzen Sie Förderprogramme, vorzeitige Erbschaften oder Schenkungen, private Darlehen oder Immobilienbeleihung. Auch Eigenleistungen können einen Teil der Finanzierung ersetzen.
Wie unterscheiden sich die Anforderungen zwischen den Banken?
Viele Banken empfehlen 20 bis 30 % Eigenkapital, einige sind bei 10 % flexibler, verlangen aber höhere Sicherheiten oder Zinssätze. Eine individuelle Beratung ist hier sehr zu empfehlen.


